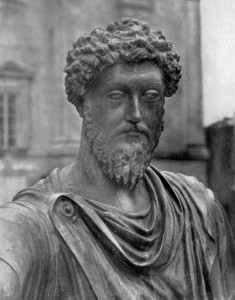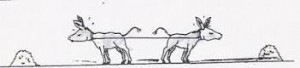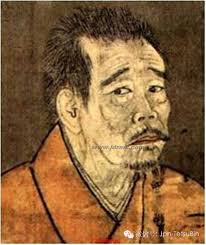Vor ein paar Tagen waren die beiden wieder im niederösterreichischen Scheibbs zu Gast. Das Haus war voll, fast 40 TeilnehmerInnen aus Österreich, Italien, England, Schweden, Polen, Frankreich, Deutschland waren angereist gekommen, um sie zu hören. Von Anfang an herrschte eine gesammelte Atmosphäre, die die Mitte zwischen Anspannung und Entspannung hielt; zu schweigen fiel uns nicht schwer. Die wenigen Gruppen-Regeln wurden unaufgeregt vorgegeben und eingehalten. Martine betonte mehrmals, wir sollten aus ihren Angeboten von Meditationsformen auswählen, was für uns geeignet sei, und auch bei der Sitzposition gut auf unsere persönlichen körperlichen Möglichkeiten achten und uns nicht überanstrengen. Beide sprachen täglich eine Stunde lang zu uns, wobei Stephen am Vormittag Elemente seiner Studien von Texten aus dem Pali-Kanon 1 präsentierte, während Martine uns abends vor allem Inhalte und Praxis von Meditation nahe brachte. Beides kann ich nicht im Ganzen wiedergeben, aber hier folgen ein paar Bruchstücke aus meiner Mitschrift 2.
Vor ein paar Tagen waren die beiden wieder im niederösterreichischen Scheibbs zu Gast. Das Haus war voll, fast 40 TeilnehmerInnen aus Österreich, Italien, England, Schweden, Polen, Frankreich, Deutschland waren angereist gekommen, um sie zu hören. Von Anfang an herrschte eine gesammelte Atmosphäre, die die Mitte zwischen Anspannung und Entspannung hielt; zu schweigen fiel uns nicht schwer. Die wenigen Gruppen-Regeln wurden unaufgeregt vorgegeben und eingehalten. Martine betonte mehrmals, wir sollten aus ihren Angeboten von Meditationsformen auswählen, was für uns geeignet sei, und auch bei der Sitzposition gut auf unsere persönlichen körperlichen Möglichkeiten achten und uns nicht überanstrengen. Beide sprachen täglich eine Stunde lang zu uns, wobei Stephen am Vormittag Elemente seiner Studien von Texten aus dem Pali-Kanon 1 präsentierte, während Martine uns abends vor allem Inhalte und Praxis von Meditation nahe brachte. Beides kann ich nicht im Ganzen wiedergeben, aber hier folgen ein paar Bruchstücke aus meiner Mitschrift 2.  Martine leitete uns in Meditation an, sie schlug verschiedene Techniken wie Atemmeditation, inneres Fragen und Körperwahrnehmung vor, denen gemeinsam sei, einen Zustand von weit offenem Gewahrsein anzustreben. Immer wieder hat sie darauf hingewiesen, dass jede/r selber herausfinden müsse, welche Form in welcher Situation für sie oder ihn persönlich geeignet sei:
Martine leitete uns in Meditation an, sie schlug verschiedene Techniken wie Atemmeditation, inneres Fragen und Körperwahrnehmung vor, denen gemeinsam sei, einen Zustand von weit offenem Gewahrsein anzustreben. Immer wieder hat sie darauf hingewiesen, dass jede/r selber herausfinden müsse, welche Form in welcher Situation für sie oder ihn persönlich geeignet sei:
Welche der vielen verschiedenen Meditationstechniken du gebrauchst, ist nicht die Hauptsache. Es geht immer um das Kultivieren von Samatha und Vipassana: sich im Augenblick zu verankern und Einsicht zu gewinnen, wie die Dinge wirklich sind. Der Zustand von Sati, von Achtsamkeit, bedeutet nicht, auf die Wirklichkeit zu starren. Er bedeutet, fürsorglich mit sich und anderen zu sein, harmlos und geistesgegenwärtig. Es geht darum, Hindernisse aufzulösen, die unser kreatives Potential blockieren. Vedanas, Empfindungen, die positiv, negativ oder neutral sein können, entstehen unausweichlich als Folgen unserer Sinneswahrnehmungen. In der Meditation geht es darum, sie sich bewusst zu machen und an keiner festzuhalten. Das macht kreatives Engagement möglich. Durch Meditation können so Offenheit und Freude entstehen.
Martine hat ihre Talks mit sehr lebensnahen Beispielen illustriert, in denen sie – ohne in Details zu gehen – aus persönlichen Erfahrungen ihre Schlüsse für uns zog. Wie kann man in beunruhigenden Situationen durch Bewusstmachen Ruhe bewahren? Wie kann frau ihre Selbst-Akzeptanz stärken, wenn sie in Gefahr ist, sich übertrieben zu kritisieren? Und, schließlich: wie kann man nach einem intensiven Retreat seine Meditationspraxis aufrechterhalten und stärken? 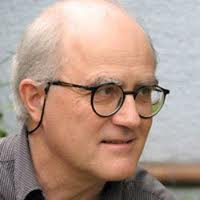 Stephen betonte, dass Praxis und Studium nicht getrennt werden könnten und erklärte so das Design des Studienretreats. Der Pali-Kanon enthalte viel reiches Material, das von den buddhistischen Orthodoxien nicht aufgegriffen worden sei – manches davon stehe im Widerspruch zu ihnen. Das interessiere ihn besonders. Er ging vom Thema der Todlosigkeit aus, die er ein Äquivalent zur christlichen Erlösung nennt:
Stephen betonte, dass Praxis und Studium nicht getrennt werden könnten und erklärte so das Design des Studienretreats. Der Pali-Kanon enthalte viel reiches Material, das von den buddhistischen Orthodoxien nicht aufgegriffen worden sei – manches davon stehe im Widerspruch zu ihnen. Das interessiere ihn besonders. Er ging vom Thema der Todlosigkeit aus, die er ein Äquivalent zur christlichen Erlösung nennt:
In einer Lehrrede geht es um 21 Laien aus Buddhas Anhängerschaft 3, die Todlosigkeit erkannt und Erfüllung erreicht hätten; so gingen sie durchs Leben, in vollkommenem Vertrauen auf Buddha, Dharma und Sangha. Der Dharma sei für sie klar sichtbar geworden, unmittelbar, erhebend, einladend und er könne von weisen Menschen wie ihnen persönlich erfahren werden. Diese heute weitgehend unbekannten Männer waren in der neuen städtischen Gesellschaft, die sich zu Buddhas Zeit gerade entwickelte, in verschiedenen Berufen tätig, sie waren keine Mönche. Buddha richtete seine Lehrreden oft an Menschen wie sie; er sagte ja von sich, er sei kein Lehrer mit geschlossener Faust – er meinte damit, dass er nichts für Eingeweihte zurückhalte. Darin, dass diese Männer die Todlosigkeit erkannt haben, liegt also Hoffnung für uns Laien. Was kann mit Todlosigkeit gemeint sein, da Buddha ja das Konzept einer unsterblichen Seele ablehnte? Nach seinen Worten bedeutet sie das Ende von Gier, Hass und Verblendung. Diese werden als reaktive Muster von Empfindungen des Vergnügens, der Unlust oder der Langeweile ausgelöst. Orthodoxen buddhistischen Schulen entsprechend müssten sie eliminiert werden. Sie sind aber tief in uns verwurzelt. Achtsamkeit zu üben bedeutet, sie zu akzeptieren. Und hier liegt der Schlüssel zur Todlosigkeit: sie ist ein Geisteszustand ohne reaktive Muster, nicht getrieben, sondern voll innerer Freiheit, in jedem Augenblick zugänglich. Es ist das, was wir in der Meditation üben – die Erfahrung jener Momente zu stärken, in denen wir nicht abhängig sind, sondern uns im Fluss des Geschehens bewegen. Das ist gemeint mit: in den Strom eintauchen. Todlosigkeit ist für Buddha eng mit dem Körper verbunden: er ist die Basis, die uns unsere Lebendigkeit empfinden lässt. Wer sich der Todlosigkeit erfreut, erfreut sich der Achtsamkeit für seinen Körper. Meditation beginnt für Buddha im Körper. Und sie bedeutet, uns bewusst zu machen, dass nicht nur Gier, Hass und Verblendung in uns sind. Solange wir am Leben sind, entgehen wir Dukkha, der conditio humana, nicht. Gier und Hass sind tief in uns verwurzelt. In der Geschichte der Menschheit waren sie erfolgreiche Mittel, um ihr Überleben zu sichern. Religionen, Moral- und Rechtsvorschriften dienen dazu, sie unter Kontrolle zu halten. Dabei besteht für alle Religionen die Gefahr der Entfremdung von ihren ursprünglichen Zielen, wenn sie sich mit Vertretern der Macht einlassen. Ich halte das für den Koan unserer Zeit: kultivieren wir unser inneres Leben oder engagieren wir uns in der Welt? Retreats können uns für die Aufgabe stärken, uns nachdrücklich für Ziele einzusetzen. Wenn wir diese Dichotomie zwischen Kontemplation und Aktivität überwinden, eröffnet sich ein neuer Raum und wir können die Erfahrung von Ganzheit neu entwickeln. Meditation ist keine Technik, sondern bedeutet, Sensibilität zu entwickeln. Wir brauchen Disziplin und Praxis, um uns für die Welt zu öffnen. Dazu gehört radikale Selbst-Akzeptanz und gleichzeitig das Durchbrechen der Obsession, „Ich, Mich und Mein“ wären Angelpunkte der Welt. Dann entstehen Fürsorglichkeit und Engagement für andere Menschen. Wir sollten für uns selbst eine Insel sein, wie Buddha es kurz vor seinem Tod formuliert hat, und nirgends sonst Zuflucht suchen. Ziel unserer Praxis sind Unabhängigkeit und Autonomie. Gleichzeitig gilt: in der Gemeinschaft sollen wir Zuflucht nehmen. Der Unterschied zwischen Kollektiv und Gemeinschaft liegt darin, dass dort Konformität auf Kosten der Autonomie gefragt ist, während hier jedes Mitglied die Individuation jedes anderen Mitglieds fördert. So gesehen besteht da kein Widerspruch.
All das zu hören und aufzunehmen war intensiv, erfrischend und anregend. Ich möchte ein paar Gedanken und Empfindungen anfügen, die bei mir entstanden sind. Es gibt den Modus „Pfeil“ im Leben, wenn es um das Erreichen von Zielen geht. Er führt leicht in Hast und Schärfe. Und es gibt den manchmal entgegengesetzten, manchmal komplementären Modus „Kreislauf“: Dinge entstehen und vergehen ohne Zutun; es ist möglich, dem achtsam zu folgen. Ohne das Anstreben von Zielen geht es nicht, die Kunst ist aber, immer wieder auf „Kreislauf“ umzuschalten. Dafür sitze ich im Retreat. Als Kind habe ich so gern den Wolken zugesehen. Ich möchte mich diesem stillen Zustand wieder annähern, den ich genossen habe, auch wenn meine Mutter mich dann gescholten hat, ich sei faul. An guten Tagen kann Meditation eine große Freude sein: sich dem Fluss der Dinge überlassen. Gleichzeitig mit der Wahrnehmung öffnet sich das Herz. Mit der Sitzposition habe ich, ermutigt durch Martines Anleitungen und ihr Vorbild (sie selbst sitzt auf einem Sessel) experimentiert, um eine gleichzeitig gesammelte und entspannte Haltung zu finden. Wie bei früheren Retreats habe ich erfahren, wie das „Ich-Mich-Mein“ manchmal in den Hintergrund tritt und sich auch wieder mal vordrängt, während ich mich unter den anderen bewege. Unsere Gruppe, die diese Website betreibt, konnte ein freundschaftliches Gespräch mit Stephen und Martine führen, das uns ermutigt hat. Am Ende des Retreats haben wir uns und unsere Arbeit allen Anwesenden vorgestellt und von dem Peer-Retreat in Scheibbs erzählt, das wir für 2.-5. Oktober 2014 vorbereiten. Martine und Stephen Batchelor werden von 24.- 28. Juni 2015 wieder nach Österreich kommen. Näheres dazu auf der Seite „Veranstaltungen“.
alabama nil jersey
Keelon Russell Jersey
Michael Carroll Jersey
Dijon Lee Jr. Jersey
Ivan Taylor Jersey
Jackson Lloyd Jersey
Derek Meadows Jersey
Justin Hill Jersey
Ryan Williams Jersey
Ty Simpson Jersey
alabama nil jerseys
Ryan Williams Alabama Jersey
Isaiah Horton Alabama Jersey
Germie Bernard Alabama Jersey
Ty Simpson Alabama Jersey
Jam Miller Alabama Jersey
Keelon Russell Alabama Jersey
Austin Mack Alabama Jersey
Dijon Lee Jr. Alabama Jersey
crimson tide pro store
Ryan Williams Alabama Jersey
Isaiah Horton Alabama Jersey
Germie Bernard Alabama Jersey
Ty Simpson Alabama Jersey
Jam Miller Alabama Jersey
Keelon Russell Alabama Jersey
Austin Mack Alabama Jersey
Dijon Lee Jr. Alabama Jersey
Richard Young Alabama Jersey
roll tide pro shop
Ryan Williams Alabama Crimson Tide Jersey
Isaiah Horton Alabama Crimson Tide Jersey
Germie Bernard Alabama Crimson Tide Jersey
Ty Simpson Alabama Crimson Tide Jersey
Jam Miller Alabama Crimson Tide Jersey
Keelon Russell Alabama Crimson Tide Jersey
Austin Mack Alabama Crimson Tide Jersey
Dijon Lee Jr. Alabama Crimson Tide Jersey
Richard Young Alabama Crimson Tide Jersey
clemson nil jersey
Cade Klubnik Jersey
Christopher Vizzina Jersey
Gideon Davidson Jersey
Keith Adams Jr. Jersey
T.J. Moore Jersey
Bryant Wesco Jr. Jersey
Antonio Williams Jersey
Cole Turner Jersey
Tristan Smith Jersey
Tyler Brown Jersey
Avieon Terrell Jersey
clemson football pro shop
Cade Klubnik Football Jersey
Christopher Vizzina Football Jersey
Gideon Davidson Football Jersey
Keith Adams Jr. Football Jersey
T.J. Moore Football Jersey
Bryant Wesco Jr. Football Jersey
Antonio Williams Football Jersey
Cole Turner Football Jersey
Tristan Smith Football Jersey
Tyler Brown Football Jersey
Avieon Terrell Football Jersey
cu pro shop
Cade Klubnik Clemson Jersey
Christopher Vizzina Clemson Jersey
Gideon Davidson Clemson Jersey
Keith Adams Jr. Clemson Jersey
T.J. Moore Clemson Jersey
Bryant Wesco Jr. Clemson Jersey
Antonio Williams Clemson Jersey
Cole Turner Clemson Jersey
Tristan Smith Clemson Jersey
Tyler Brown Clemson Jersey
Avieon Terrell Clemson Jersey
clemson nil jerseys
Cade Klubnik Clemson Tigers Jersey
Christopher Vizzina Clemson Tigers Jersey
Gideon Davidson Clemson Tigers Jersey
Keith Adams Jr. Clemson Tigers Jersey
T.J. Moore Clemson Tigers Jersey
Bryant Wesco Jr. Clemson Tigers Jersey
Antonio Williams Clemson Tigers Jersey
Cole Turner Clemson Tigers Jersey
Tristan Smith Clemson Tigers Jersey
Tyler Brown Clemson Tigers Jersey
Avieon Terrell Clemson Tigers Jersey
seminoles store
Tommy Castellanos Jersey
Duce Robinson Jersey
Jayvan Boggs Jersey
Squirrel White Jersey
Markeston Douglas Jersey
Gavin Sawchuk Jersey
Justin Cryer Jersey
Brock Glenn Jersey
Gavin Blackwell Jersey
Chase Loftin Jersey
Micahi Danzy Jersey
Amaree Williams Jersey
Jaylin Lucas Jersey
Blake Nichelson Jersey
seminoles football shop
Tommy Castellanos Football Jersey
Duce Robinson Football Jersey
Jayvan Boggs Football Jersey
Squirrel White Football Jersey
Markeston Douglas Football Jersey
Gavin Sawchuk Football Jersey
Justin Cryer Football Jersey
Brock Glenn Football Jersey
Gavin Blackwell Football Jersey
Chase Loftin Football Jersey
Micahi Danzy Football Jersey
Amaree Williams Football Jersey
Jaylin Lucas Football Jersey
Blake Nichelson Football Jersey
noles pro shop
Tommy Castellanos Florida State Jersey
Duce Robinson Florida State Jersey
Jayvan Boggs Florida State Jersey
Squirrel White Florida State Jersey
Markeston Douglas Florida State Jersey
Gavin Sawchuk Florida State Jersey
Justin Cryer Florida State Jersey
Brock Glenn Florida State Jersey
Gavin Blackwell Florida State Jersey
Chase Loftin Florida State Jersey
Micahi Danzy Florida State Jersey
Amaree Williams Florida State Jersey
Jaylin Lucas Florida State Jersey
Blake Nichelson Florida State Jersey
fsu seminoles shop
Tommy Castellanos FSU Jersey
Duce Robinson FSU Jersey
Jayvan Boggs FSU Jersey
Squirrel White FSU Jersey
Markeston Douglas FSU Jersey
Gavin Sawchuk FSU Jersey
Justin Cryer FSU Jersey
Brock Glenn FSU Jersey
Gavin Blackwell FSU Jersey
Chase Loftin FSU Jersey
Micahi Danzy FSU Jersey
Amaree Williams FSU Jersey
Jaylin Lucas FSU Jersey
Blake Nichelson FSU Jersey
georgia nil jersey
Gunner Stockton Jersey
Nate Frazier Jersey
Zachariah Branch Jersey
Colbie Young Jersey
Dillon Bell Jersey
Oscar Delp Jersey
Lawson Luckie Jersey
Chauncey Bowens Jersey
Ryan Puglisi Jersey
Sacovie White-Helton Jersey
Dwight Phillips Jr. Jersey
Zion Branch Jersey
georgia nil jerseys
Gunner Stockton Georgia Jersey
Nate Frazier Georgia Jersey
Zachariah Branch Georgia Jersey
Colbie Young Georgia Jersey
Dillon Bell Georgia Jersey
Oscar Delp Georgia Jersey
Lawson Luckie Georgia Jersey
Chauncey Bowens Georgia Jersey
Ryan Puglisi Georgia Jersey
Sacovie White-Helton Georgia Jersey
Dwight Phillips Jr. Georgia Jersey
Zion Branch Georgia Jersey
georgia bulldogs pro store
Gunner Stockton Georgia Bulldogs Jersey
Nate Frazier Georgia Bulldogs Jersey
Zachariah Branch Georgia Bulldogs Jersey
Colbie Young Georgia Bulldogs Jersey
Dillon Bell Georgia Bulldogs Jersey
Oscar Delp Georgia Bulldogs Jersey
Lawson Luckie Georgia Bulldogs Jersey
Chauncey Bowens Georgia Bulldogs Jersey
Ryan Puglisi Georgia Bulldogs Jersey
Sacovie White-Helton Georgia Bulldogs Jersey
Dwight Phillips Jr. Georgia Bulldogs Jersey
Zion Branch Georgia Bulldogs Jersey
dawgs pro shop
Gunner Stockton UGA Jersey
Nate Frazier UGA Jersey
Zachariah Branch UGA Jersey
Colbie Young UGA Jersey
Dillon Bell UGA Jersey
Oscar Delp UGA Jersey
Lawson Luckie UGA Jersey
Chauncey Bowens UGA Jersey
Ryan Puglisi UGA Jersey
Sacovie White-Helton UGA Jersey
Dwight Phillips Jr. UGA Jersey
Zion Branch UGA Jersey
lsu tiger nation shop
Garrett Nussmeier Jersey
Nic Anderson Jersey
Barion Brown Jersey
Aaron Anderson Jersey
Caden Durham Jersey
Trey’Dez Green Jersey
Whit Weeks Jersey
Michael Van Buren Jr. Jersey
Kaleb Jackson Jersey
Chris Hilton Jr. Jersey
Kyle Parker Jersey
Zavion Thomas Jersey
lsu football pro shop
Garrett Nussmeier LSU Jersey
Nic Anderson LSU Jersey
Barion Brown LSU Jersey
Aaron Anderson LSU Jersey
Caden Durham LSU Jersey
Trey’Dez Green LSU Jersey
Whit Weeks LSU Jersey
Michael Van Buren Jr. LSU Jersey
Kaleb Jackson LSU Jersey
Chris Hilton Jr. LSU Jersey
Kyle Parker LSU Jersey
Zavion Thomas LSU Jersey
lsu nil jersey
LSU Garrett Nussmeier Jersey
LSU Nic Anderson Jersey
LSU Barion Brown Jersey
LSU Aaron Anderson Jersey
LSU Caden Durham Jersey
LSU Trey’Dez Green Jersey
LSU Whit Weeks Jersey
LSU Michael Van Buren Jr. Jersey
LSU Kaleb Jackson Jersey
LSU Chris Hilton Jr. Jersey
LSU Kyle Parker Jersey
LSU Zavion Thomas Jersey
lsu nil jerseys
Garrett Nussmeier LSU Tigers Jersey
Nic Anderson LSU Tigers Jersey
Barion Brown LSU Tigers Jersey
Aaron Anderson LSU Tigers Jersey
Caden Durham LSU Tigers Jersey
Trey’Dez Green LSU Tigers Jersey
Whit Weeks LSU Tigers Jersey
Michael Van Buren Jr. LSU Tigers Jersey
Kaleb Jackson LSU Tigers Jersey
Chris Hilton Jr. LSU Tigers Jersey
Kyle Parker LSU Tigers Jersey
Zavion Thomas LSU Tigers Jersey
miami nil jersey
Carson Beck Jersey
CJ Daniels Jersey
Keelan Marion Jersey
Malachi Toney Jersey
Alex Bauman Jersey
Elija Lofton Jersey
Mark Fletcher Jr. Jersey
Wesley Bissainthe Jersey
Jordan Lyle Jersey
Emory Williams Jersey
Joshisa Trader Jersey
Joshua Moore Jersey
Ray Ray Joseph Jersey
Brock Schott Jersey
Luka Gilbert Jersey
miami nil jerseys
Carson Beck Jerseys
CJ Daniels Jerseys
Keelan Marion Jerseys
Malachi Toney Jerseys
Alex Bauman Jerseys
Elija Lofton Jerseys
Mark Fletcher Jr. Jerseys
Wesley Bissainthe Jerseys
Jordan Lyle Jerseys
Emory Williams Jerseys
Joshisa Trader Jerseys
Joshua Moore Jerseys
Ray Ray Joseph Jerseys
Brock Schott Jerseys
Luka Gilbert Jerseys
hurricanes football jersey
Carson Beck Football Jersey
CJ Daniels Football Jersey
Keelan Marion Football Jersey
Malachi Toney Football Jersey
Alex Bauman Football Jersey
Elija Lofton Football Jersey
Mark Fletcher Jr. Football Jersey
Wesley Bissainthe Football Jersey
Jordan Lyle Football Jersey
Emory Williams Football Jersey
Joshisa Trader Football Jersey
Joshua Moore Football Jersey
Ray Ray Joseph Football Jersey
Brock Schott Football Jersey
Luka Gilbert Football Jersey
hurricanes college jersey
Carson Beck College Jersey
CJ Daniels College Jersey
Keelan Marion College Jersey
Malachi Toney College Jersey
Alex Bauman College Jersey
Elija Lofton College Jersey
Mark Fletcher Jr. College Jersey
Wesley Bissainthe College Jersey
Jordan Lyle College Jersey
Emory Williams College Jersey
Joshisa Trader College Jersey
Joshua Moore College Jersey
Ray Ray Joseph College Jersey
Brock Schott College Jersey
Luka Gilbert College Jersey
michigan nil jersey
Bryce Underwood Jersey
Donaven McCulley Jersey
Fredrick Moore Jersey
Semaj Morgan Jersey
Marlin Klein Jersey
Justice Haynes Jersey
Ernest Hausmann Jersey
Channing Goodwin Jersey
Jamar Browder Jersey
Anthony Simpson Jersey
Hogan Hansen Jersey
Mikey Keene Jersey
Jordan Marshall Jersey
Cole Sullivan Jersey
michigan nil jerseys
Bryce Underwood Michigan Jersey
Donaven McCulley Michigan Jersey
Fredrick Moore Michigan Jersey
Semaj Morgan Michigan Jersey
Marlin Klein Michigan Jersey
Justice Haynes Michigan Jersey
Ernest Hausmann Michigan Jersey
Channing Goodwin Michigan Jersey
Jamar Browder Michigan Jersey
Anthony Simpson Michigan Jersey
Hogan Hansen Michigan Jersey
Mikey Keene Michigan Jersey
Jordan Marshall Michigan Jersey
Cole Sullivan Michigan Jersey
wolverines football shop
Bryce Underwood Football Jersey
Donaven McCulley Football Jersey
Fredrick Moore Football Jersey
Semaj Morgan Football Jersey
Marlin Klein Football Jersey
Justice Haynes Football Jersey
Ernest Hausmann Football Jersey
Channing Goodwin Football Jersey
Jamar Browder Football Jersey
Anthony Simpson Football Jersey
Hogan Hansen Football Jersey
Mikey Keene Football Jersey
Jordan Marshall Football Jersey
Cole Sullivan Football Jersey
wolverines football jerseys
Bryce Underwood Jerseys
Donaven McCulley Jerseys
Fredrick Moore Jerseys
Semaj Morgan Jerseys
Marlin Klein Jerseys
Justice Haynes Jerseys
Ernest Hausmann Jerseys
Channing Goodwin Jerseys
Jamar Browder Jerseys
Anthony Simpson Jerseys
Hogan Hansen Jerseys
Mikey Keene Jerseys
Jordan Marshall Jerseys
Cole Sullivan Jerseys
osu buckeyes pro shop
Julian Sayin Jersey
Jeremiah Smith Jersey
Carnell Tate Jersey
Brandon Inniss Jersey
James Peoples Jersey
Max Klare Jersey
Caleb Downs Jersey
Arvell Reese Jersey
Lincoln Kienholz Jersey
CJ Donaldson Jersey
Quincy Porter Jersey
Mylan Graham Jersey
Bryson Rodgers Jersey
go bucks pro store
Julian Sayin Ohio State Jersey
Jeremiah Smith Ohio State Jersey
Carnell Tate Ohio State Jersey
Brandon Inniss Ohio State Jersey
James Peoples Ohio State Jersey
Max Klare Ohio State Jersey
Caleb Downs Ohio State Jersey
Arvell Reese Ohio State Jersey
Lincoln Kienholz Ohio State Jersey
CJ Donaldson Ohio State Jersey
Quincy Porter Ohio State Jersey
Mylan Graham Ohio State Jersey
Bryson Rodgers Ohio State Jersey
ohio state nil jersey
Ohio State Julian Sayin Jersey
Ohio State Jeremiah Smith Jersey
Ohio State Carnell Tate Jersey
Ohio State Brandon Inniss Jersey
Ohio State James Peoples Jersey
Ohio State Max Klare Jersey
Ohio State Caleb Downs Jersey
Ohio State Arvell Reese Jersey
Ohio State Lincoln Kienholz Jersey
Ohio State CJ Donaldson Jersey
Ohio State Quincy Porter Jersey
Ohio State Mylan Graham Jersey
Ohio State Bryson Rodgers Jersey
ohio state nil jerseys
Julian Sayin OSU Jersey
Jeremiah Smith OSU Jersey
Carnell Tate OSU Jersey
Brandon Inniss OSU Jersey
James Peoples OSU Jersey
Max Klare OSU Jersey
Caleb Downs OSU Jersey
Arvell Reese OSU Jersey
Lincoln Kienholz OSU Jersey
CJ Donaldson OSU Jersey
Quincy Porter OSU Jersey
Mylan Graham OSU Jersey
Bryson Rodgers OSU Jersey
oklahoma nil jersey
John Mateer Jersey
Keontez Lewis Jersey
Deion Burks Jersey
Isaiah Sategna III Jersey
Jaren Kanak Jersey
Tory Blaylock Jersey
Kobie McKinzie Jersey
Ivan Carreon Jersey
Jer’Michael Carter Jersey
Zion Kearney Jersey
Will Huggins Jersey
Michael Hawkins Jr. Jersey
Jovantae Barnes Jersey
Sammy Omosigho Jersey
oklahoma nil jerseys
John Mateer Jerseys
Keontez Lewis Jerseys
Deion Burks Jerseys
Isaiah Sategna III Jerseys
Jaren Kanak Jerseys
Tory Blaylock Jerseys
Kobie McKinzie Jerseys
Ivan Carreon Jerseys
Jer’Michael Carter Jerseys
Zion Kearney Jerseys
Will Huggins Jerseys
Michael Hawkins Jr. Jerseys
Jovantae Barnes Jerseys
Sammy Omosigho Jerseys
oklahoma sooners pro store
John Mateer Oklahoma Sooners Jersey
Keontez Lewis Oklahoma Sooners Jersey
Deion Burks Oklahoma Sooners Jersey
Isaiah Sategna III Oklahoma Sooners Jersey
Jaren Kanak Oklahoma Sooners Jersey
Tory Blaylock Oklahoma Sooners Jersey
Kobie McKinzie Oklahoma Sooners Jersey
Ivan Carreon Oklahoma Sooners Jersey
Jer’Michael Carter Oklahoma Sooners Jersey
Zion Kearney Oklahoma Sooners Jersey
Will Huggins Oklahoma Sooners Jersey
Michael Hawkins Jr. Oklahoma Sooners Jersey
Jovantae Barnes Oklahoma Sooners Jersey
Sammy Omosigho Oklahoma Sooners Jersey
oklahoma college shop
John Mateer Oklahoma Jersey
Keontez Lewis Oklahoma Jersey
Deion Burks Oklahoma Jersey
Isaiah Sategna III Oklahoma Jersey
Jaren Kanak Oklahoma Jersey
Tory Blaylock Oklahoma Jersey
Kobie McKinzie Oklahoma Jersey
Ivan Carreon Oklahoma Jersey
Jer’Michael Carter Oklahoma Jersey
Zion Kearney Oklahoma Jersey
Will Huggins Oklahoma Jersey
Michael Hawkins Jr. Oklahoma Jersey
Jovantae Barnes Oklahoma Jersey
Sammy Omosigho Oklahoma Jersey
penn state nil jersey
Drew Allar Jersey
Nicholas Singleton Jersey
Devonte Ross Jersey
Kyron Hudson Jersey
Khalil Dinkins Jersey
Kaytron Allen Jersey
Liam Clifford Jersey
Tyseer Denmark Jersey
Elliot Washington II Jersey
Peter Gonzalez Jersey
Ethan Grunkemeyer Jersey
penn state nil jerseys
Drew Allar Penn State Jersey
Nicholas Singleton Penn State Jersey
Devonte Ross Penn State Jersey
Kyron Hudson Penn State Jersey
Khalil Dinkins Penn State Jersey
Kaytron Allen Penn State Jersey
Liam Clifford Penn State Jersey
Tyseer Denmark Penn State Jersey
Elliot Washington II Penn State Jersey
Peter Gonzalez Penn State Jersey
Ethan Grunkemeyer Penn State Jersey
penn state nittany lions gear
Drew Allar PSU Jersey
Nicholas Singleton PSU Jersey
Devonte Ross PSU Jersey
Kyron Hudson PSU Jersey
Khalil Dinkins PSU Jersey
Kaytron Allen PSU Jersey
Liam Clifford PSU Jersey
Tyseer Denmark PSU Jersey
Elliot Washington II PSU Jersey
Peter Gonzalez PSU Jersey
Ethan Grunkemeyer PSU Jersey
penn state nittany lions shop
Penn State Drew Allar Jersey
Penn State Nicholas Singleton Jersey
Penn State Devonte Ross Jersey
Penn State Kyron Hudson Jersey
Penn State Khalil Dinkins Jersey
Penn State Kaytron Allen Jersey
Penn State Liam Clifford Jersey
Penn State Tyseer Denmark Jersey
Penn State Elliot Washington II Jersey
Penn State Peter Gonzalez Jersey
Penn State Ethan Grunkemeyer Jersey
south carolina nil jersey
LaNorris Sellers Jersey
Nyck Harbor Jersey
Brian Rowe Jersey
Mazeo Bennett Jr. Jersey
Brady Hunt Jersey
Rahsul Faison Jersey
Dylan Stewart Jersey
Fred Johnson Jersey
Donovan Murph Jersey
Jared Brown Jersey
Michael Smith Jersey
Luke Doty Jersey
Oscar Adaway III Jersey
south carolina nil jerseys
LaNorris Sellers Jerseys
Nyck Harbor Jerseys
Brian Rowe Jerseys
Mazeo Bennett Jr. Jerseys
Brady Hunt Jerseys
Rahsul Faison Jerseys
Dylan Stewart Jerseys
Fred Johnson Jerseys
Donovan Murph Jerseys
Jared Brown Jerseys
Michael Smith Jerseys
Luke Doty Jerseys
Oscar Adaway III Jerseys
south carolina pro store
LaNorris Sellers South Carolina Jersey
Nyck Harbor South Carolina Jersey
Brian Rowe South Carolina Jersey
Mazeo Bennett Jr. South Carolina Jersey
Brady Hunt South Carolina Jersey
Rahsul Faison South Carolina Jersey
Dylan Stewart South Carolina Jersey
Fred Johnson South Carolina Jersey
Donovan Murph South Carolina Jersey
Jared Brown South Carolina Jersey
Michael Smith South Carolina Jersey
Luke Doty South Carolina Jersey
Oscar Adaway III South Carolina Jersey
gamecock college shop
LaNorris Sellers Gamecocks Jersey
Nyck Harbor Gamecocks Jersey
Brian Rowe Gamecocks Jersey
Mazeo Bennett Jr. Gamecocks Jersey
Brady Hunt Gamecocks Jersey
Rahsul Faison Gamecocks Jersey
Dylan Stewart Gamecocks Jersey
Fred Johnson Gamecocks Jersey
Donovan Murph Gamecocks Jersey
Jared Brown Gamecocks Jersey
Michael Smith Gamecocks Jersey
Luke Doty Gamecocks Jersey
Oscar Adaway III Gamecocks Jersey
tennessee nil jersey
Joey Aguilar Jersey
Mike Matthews Jersey
Chris Brazzell II Jersey
Braylon Staley Jersey
DeSean Bishop Jersey
Miles Kitselman Jersey
Jeremiah Telander Jersey
Jake Merklinger Jersey
Star Thomas Jersey
Ethan Davis Jersey
Travis Smith Jr. Jersey
Radarious Jackson Jersey
Joakim Dodson Jersey
Edwin Spillman Jersey
tennessee nil jerseys
Joey Aguilar Tennessee Vols Jersey
Mike Matthews Tennessee Vols Jersey
Chris Brazzell II Tennessee Vols Jersey
Braylon Staley Tennessee Vols Jersey
DeSean Bishop Tennessee Vols Jersey
Miles Kitselman Tennessee Vols Jersey
Jeremiah Telander Tennessee Vols Jersey
Jake Merklinger Tennessee Vols Jersey
Star Thomas Tennessee Vols Jersey
Ethan Davis Tennessee Vols Jersey
Travis Smith Jr. Tennessee Vols Jersey
Radarious Jackson Tennessee Vols Jersey
Joakim Dodson Tennessee Vols Jersey
Edwin Spillman Tennessee Vols Jersey
tennessee volunteers pro shop
Joey Aguilar Tennessee Jersey
Mike Matthews Tennessee Jersey
Chris Brazzell II Tennessee Jersey
Braylon Staley Tennessee Jersey
DeSean Bishop Tennessee Jersey
Miles Kitselman Tennessee Jersey
Jeremiah Telander Tennessee Jersey
Jake Merklinger Tennessee Jersey
Star Thomas Tennessee Jersey
Ethan Davis Tennessee Jersey
Travis Smith Jr. Tennessee Jersey
Radarious Jackson Tennessee Jersey
Joakim Dodson Tennessee Jersey
Edwin Spillman Tennessee Jersey
volunteers pro shop
Joey Aguilar Vols Jersey
Mike Matthews Vols Jersey
Chris Brazzell II Vols Jersey
Braylon Staley Vols Jersey
DeSean Bishop Vols Jersey
Miles Kitselman Vols Jersey
Jeremiah Telander Vols Jersey
Jake Merklinger Vols Jersey
Star Thomas Vols Jersey
Ethan Davis Vols Jersey
Travis Smith Jr. Vols Jersey
Radarious Jackson Vols Jersey
Joakim Dodson Vols Jersey
Edwin Spillman Vols Jersey
texas nil jersey
Arch Manning Jersey
Ryan Wingo Jersey
Emmett Mosley V Jersey
DeAndre Moore Jr. Jersey
Jack Endries Jersey
Quintrevion Wisner Jersey
Anthony Hill Jr. Jersey
Colin Simmons Jersey
Michael Taaffe Jersey
Parker Livingstone Jersey
CJ Baxter Jersey
Trey Owens Jersey
texas nil jerseys
Arch Manning Jerseys
Ryan Wingo Jerseys
Emmett Mosley V Jerseys
DeAndre Moore Jr. Jerseys
Jack Endries Jerseys
Quintrevion Wisner Jerseys
Anthony Hill Jr. Jerseys
Colin Simmons Jerseys
Michael Taaffe Jerseys
Parker Livingstone Jerseys
CJ Baxter Jerseys
Trey Owens Jerseys
texass pro shop
Arch Manning Texas Jersey
Ryan Wingo Texas Jersey
Emmett Mosley V Texas Jersey
DeAndre Moore Jr. Texas Jersey
Jack Endries Texas Jersey
Quintrevion Wisner Texas Jersey
Anthony Hill Jr. Texas Jersey
Colin Simmons Texas Jersey
Michael Taaffe Texas Jersey
Parker Livingstone Texas Jersey
CJ Baxter Texas Jersey
Trey Owens Texas Jersey
texas university shop
Arch Manning Texas Longhorns Jersey
Ryan Wingo Texas Longhorns Jersey
Emmett Mosley V Texas Longhorns Jersey
DeAndre Moore Jr. Texas Longhorns Jersey
Jack Endries Texas Longhorns Jersey
Quintrevion Wisner Texas Longhorns Jersey
Anthony Hill Jr. Texas Longhorns Jersey
Colin Simmons Texas Longhorns Jersey
Michael Taaffe Texas Longhorns Jersey
Parker Livingstone Texas Longhorns Jersey
CJ Baxter Texas Longhorns Jersey
Trey Owens Texas Longhorns Jersey
bulldogs football jerseys
Brock Bowers UGA Jersey
Chauncey Bowens UGA Jersey
CJ Allen UGA Jersey
Dillon Bell UGA Jersey
Gunner Stockton UGA Jersey
Lawson Luckie UGA Jersey
Nate Frazier UGA Jersey
Nick Chubb UGA Jersey
Oscar Delp UGA Jersey
Stetson Bennett UGA Jersey
georgia shop now
Bo Walker Jersey
Brock Bowers Jersey
Carson Beck Jersey
Dillon Bell Jersey
Dominic Lovett Jersey
Gunner Stockton Jersey
michigan shop now
Aidan Hutchinson Jersey
Bryce Underwood Jersey
Channing Goodwin Jersey
Colston Loveland Jersey
Donaven McCulley Jersey
J.J. McCarthy Jersey
uga pro store
Brock Bowers Jersey
Chauncey Bowens Jersey
Dillon Bell Jersey
Dominic Lovett Jersey
Gunner Stockton Jersey
Lawson Luckie Jersey
Nate Frazier Jersey
Oscar Delp Jersey
Stetson Bennett Jersey
Zachariah Branch Jersey
alabama college jerseys
Brody Dalton Jersey
Dijon Lee Jr. Jersey
Germie Bernard Jersey
Isaiah Horton Jersey
Jalen Milroe Jersey
Jam Miller Jersey
Kadyn Proctor Jersey
Marshall Pritchett Jersey
Ty Simpson Jersey
osu jersey
Caleb Downs Jersey
Carnell Tate Jersey
Carter Lowe Jersey
Denzel Burke Jersey
Emeka Egbuka Jersey
Ezekiel Elliott Jersey
Jack Sawyer Jersey
Jae’Sean Tate Jersey
James Peoples Jersey
Jeremiah Smith Jersey
Joe Burrow Jersey
Joey Bosa Jersey
Julian Sayin Jersey
TreVeyon Henderson Jersey
oregon pro store
Marcus Mariota Oregon Jersey
De’Anthony Thomas Oregon Jersey
ut jerseys
Joey Aguilar UT Jersey
Chris Brazzell II UT Jersey
DeSean Bishop UT Jersey
Braylon Staley UT Jersey
Star Thomas UT Jersey
texas pro store
Arch Manning Texas Jersey
Quintrevion Wisner Texas Jersey
Jaydon Blue Texas Jersey
Ryan Wingo Texas Jersey
Matthew Golden Texas Jersey
Isaiah Bond Texas Jersey
Michael Taaffe Texas Jersey
Anthony Hill Jr. Texas Jersey
Colin Simmons Texas Jersey
fsu football jerseys
Tommy Castellanos Jersey
Gavin Sawchuk Jersey
Duce Robinson Jersey
Micahi Danzy Jersey
tennessee football jerseys
Joey Aguilar Jersey
DeSean Bishop Jersey
Chris Brazzell II Jersey
Braylon Staley Jersey
ohio state pro shop
Bo Jackson Jersey
Caleb Downs Jersey
Jeremiah Smith Jersey
Julian Sayin Jersey
C.J. Stroud Jersey
Carnell Tate Jersey
osu football jersey
Bo Jackson OSU Jersey
Carnell Tate OSU Jersey
Jeremiah Smith OSU Jersey
Jack Sawyer OSU Jersey
Julian Sayin OSU Jersey
Florida Gators Football Jerseys
ut pro store
Arch Manning Jersey
Matthew Golden Jersey
Ryan Wingo Jersey
bama jerseys
Ty Simpson Alabama Jersey
Jam Miller Alabama Jersey
Germie Bernard Alabama Jersey
Ryan Williams Alabama Jersey
Isaiah Horton Alabama Jersey
bama pro shop
Ty Simpson Alabama Jerseys
Jam Miller Alabama Jerseys
Germie Bernard Alabama Jerseys
Derrick Henry Alabama Jerseys
Jalen Hurts Alabama Jerseys
Ty Simpson Jersey
Jam Miller Jersey
Germie Bernard Jersey
Jalen Hurts Jersey
Derrick Henry Jersey
au football jerseys
clemson watson jersey
Cade Klubnik Jersey
Adam Randall Jersey
clemson jersey for sale
Cade Klubnik Clemson Jersey
Adam Randall Clemson Jersey
Antonio Williams Clemson Jersey
uga fan shop
Gunner Stockton Jersey
Chauncey Bowens Jersey
Colbie Young Jersey
Nate Frazier Jersey
Zachariah Branch Jersey
ga bulldogs jersey
Brock Bowers UGA Jersey
Colbie Young UGA Jersey
Dillon Bell UGA Jersey
Gunner Stockton UGA Jersey
Chauncey Bowens UGA Jersey
ga bulldogs jerseys
Gunner Stockton UGA Jerseys
Herschel Walker UGA Jerseys
Ladd McConkey UGA Jerseys
Lawson Luckie UGA Jerseys
Nate Frazier UGA Jerseys
Zachariah Branch UGA Jerseys
michigan football jerseys
Bryce Underwood Jersey
Justice Haynes Jersey
Donaven McCulley Jersey
J.J. McCarthy Jersey
Jordan Marshall Jersey
Andrew Marsh Jersey
brady michigan jersey
Bryce Underwood Michigan Jersey
Jasper Parker Michigan Jersey
Jordan Marshall Michigan Jersey
Jordan Poole Michigan Jersey
Tom Brady Michigan Jersey
charles woodson michigan jersey
vol pro shop
Alvin Kamara Jersey
Arian Foster Jersey
Eric Berry Jersey
Joshua Dobbs Jersey
Peyton Manning Jersey
vols pro shop
vol jersey
Florida Gators Pro Shop
clemson tigers pro store
Cade Klubnik Clemson Tigers Jersey
Adam Randall Clemson Tigers Jersey
georgia pro shop
Gunner Stockton Georgia Bulldogs Jersey
Chauncey Bowens Georgia Bulldogs Jersey
Colbie Young Georgia Bulldogs Jersey
Nate Frazier Georgia Bulldogs Jersey
tennessee volunteers jerseys
Joey Aguilar Tennessee Volunteers Jersey
DeSean Bishop Tennessee Volunteers Jersey
Chris Brazzell II Tennessee Volunteers Jersey
michigan wolverines jerseys
Aidan Hutchinson Michigan Wolverines Jersey
Bryce Underwood Michigan Wolverines Jersey
Justice Haynes Michigan Wolverines Jersey
Donaven McCulley Michigan Wolverines Jersey
Andrew Marsh Michigan Wolverines Jersey
Jasper Parker Michigan Wolverines Jersey
texas longhorns pro store
Arch Manning Texas Longhorns Jersey
Quintrevion Wisner Texas Longhorns Jersey
Jerrick Gibson Texas Longhorns Jersey
Parker Livingstone Texas Longhorns Jersey
Ryan Wingo Texas Longhorns Jersey
und pro shop
Jeremiyah Love Notre Dame Fighting Irish Jersey
Jadarian Price Notre Dame Fighting Irish Jersey
usc trojans jerseys
JuJu Smith-Schuster USC Trojans Jersey
Reggie Bush USC Trojans Jersey
Troy Polamalu USC Trojans Jersey
florida state seminoles jersey
Tommy Castellanos Florida State Seminoles Jersey
Gavin Sawchuk Florida State Seminoles Jersey
Duce Robinson Florida State Seminoles Jersey
Micahi Danzy Florida State Seminoles Jersey
miami hurricanes jerseys
wisconsin badgers jerseys
kansas state wildcats jerseys
GEORGIADOGS JERSEYS
Ladd McConkey Jersey
Matthew Stafford Jersey
Nick Chubb Jersey
Stetson Bennett Jersey
iowa hawkeyes jerseys
iowa hawkeyes jersey
alabama jersey store
Ty Simpson Alabama Jersey
Jam Miller Alabama Jersey
Germie Bernard Alabama Jersey
Dijon Lee Jr. Alabama Jersey
Jalen Hurts Jersey
Jalen Milroe Jersey
clemson purple jersey
Cade Klubnik Clemson Jersey
Adam Randall Clemson Jersey
georgia football jerseys
Gunner Stockton Georgia Jersey
Elyiss Williams Georgia Jersey
London Humphreys Georgia Jersey
miami hurricanes uniforms
Cam Ward Miami Jersey
wolverines jersey shop
Blake Corum Michigan Jersey
Bryce Underwood Michigan Jersey
Colston Loveland Michigan Jersey
Donaven McCulley Michigan Jersey
notre dame pro shop
ohio football jerseys
Julian Sayin Ohio State Jersey
Bo Jackson Ohio State Jersey
Jeremiah Smith Ohio State Jersey
CJ Donaldson Ohio State Jersey
James Peoples Ohio State Jersey
tennessee volunteers jersey
Peyton Lewis Vols Jersey
Mike Matthews Vols Jersey
Braylon Staley Vols Jersey
longhorns jersey
Arch Manning Texas Jersey
Brad Spence Texas Jersey
Brock Cunningham Texas Jersey
Colin Simmons Texas Jersey
Michael Taaffe Texas Jersey
southern cal trojans jersey
Reggie Bush USC Jersey
authentic uga jersey
CJ Allen Jerseys
Colbie Young Jerseys
Dillon Bell Jerseys
Dominic Lovett Jerseys
Herschel Walker Jerseys
Lawson Luckie Jerseys
bama pro store
Ty Simpson Alabama Jersey
Austin Mack Alabama Jersey
Jam Miller Alabama Jersey
Germie Bernard Alabama Jersey
bama uniforms
Derrick Henry Jersey
DeVonta Smith Jersey
Dijon Lee Jr. Jersey
Ryan Williams Jersey
roll tide jersey
Austin Mack Alabama Jersey
Jam Miller Alabama Jersey
Ty Simpson Alabama Jersey
Germie Bernard Alabama Jersey
Ryan Williams Alabama Jersey
asu jersey
asu jerseys
arizona wildcats jersey
arizona wildcats jerseys
arkansas jersey
arkansas razorbacks jerseys
AUBURN TIGERS GEAR
Bo Jackson Auburn Jersey
Bo Nix Auburn Jersey
colorado buffaloes jersey
Shedeur Sanders Jersey
Travis Hunter Jersey
colorado buffaloes jerseys
Shedeur Sanders Colorado Jersey
Travis Hunter Colorado Jersey
florida state seminoles jerseys
Tommy Castellanos Jersey
Kevin Sperry Jersey
Gavin Sawchuk Jersey
Ousmane Kromah Jersey
Duce Robinson Jersey
Micahi Danzy Jersey
florida state pro shop
Tommy Castellanos Florida State Jersey
Gavin Sawchuk Florida State Jersey
houston cougars jerseys
illinois jersey
illinois fighting illini jersey
indiana hoosiers jersey
indiana hoosiers jerseys
iowa jersey
Cooper DeJean Jersey
iowa hawkeyes football jersey
iowa state cyclones jersey
iowa state jersey
kansas jayhawks jerseys
iowa state jersey
kansas jersey
k state jersey
k state jerseys
kentucky wildcats jersey
kentucky jersey
louisville cardinals jerseys
Lamar Jackson Jersey
louisville jersey
Lamar Jackson Louisville Jersey
louisville jerseys
Lamar Jackson Jersey
lsu pro store
Garrett Nussmeier LSU Jersey
Caden Durham LSU Jersey
Aaron Anderson LSU Jersey
Ju’Juan Johnson LSU Jersey
miami football jerseys
Sean Taylor Jersey
Ray Lewis Jersey
wolverines pro shop
Bryce Underwood Jersey
Justice Haynes Jersey
Jordan Marshall Jersey
Jordan Poole Jersey
wolverines pro store
Blake Corum Michigan Jersey
J.J. McCarthy Michigan Jersey
unc jersey
fighting irish jersey
notre dame pro store
Jeremiyah Love Notre Dame Jersey
buckeyes pro shop
Braxton Miller Jersey
C.J. Stroud Jersey
Carnell Tate Jersey
Julian Sayin Jersey
Jeremiah Smith Jersey
Bo Jackson Jersey
buckeyes pro store
CJ Donaldson Ohio State Jersey
Bo Jackson Ohio State Jersey
James Peoples Ohio State Jersey
Jeremiah Smith Ohio State Jersey
Julian Sayin Ohio State Jersey
Carnell Tate Ohio State Jersey
Max Klare Ohio State Jersey
ou sooners jerseys
John Mateer Jersey
Tory Blaylock Jersey
Isaiah Sategna III Jersey
Jaren Kanak Jersey
Deion Burks Jersey
ole miss rebels jerseys
Jaxson Dart Jersey
ole miss jerseys
Jaxson Dart Ole Miss Jersey
oregon football jersey
Tez Johnson Jersey
oregon ducks pro shop
Bo Nix Oregon Jersey
Marcus Mariota Oregon Jersey
Justin Herbert Oregon Jersey
penn state pro shop
Drew Allar Jersey
Kaytron Allen Jersey
Devonte Ross Jersey
Nicholas Singleton Jersey
Kyron Hudson Jersey
Saquon Barkley Jersey
nittany lions jersey
Drew Allar Jersey
Kyron Hudson Jersey
Kaytron Allen Jersey
Devonte Ross Jersey
Saquon Barkley Jersey
nittany lions jerseys
Saquon Barkley Penn State Jersey
Devonte Ross Penn State Jersey
Drew Allar Penn State Jersey
rutgers jersey
rutgers jerseys
south carolina jersey
LaNorris Sellers South Carolina Jersey
Rahsul Faison South Carolina Jersey
Luke Doty South Carolina Jersey
Matt Fuller South Carolina Jersey
Oscar Adaway III South Carolina Jersey
Nyck Harbor South Carolina Jersey
Donovan Murph South Carolina Jersey
stanford cardinal jerseys
Andrew Luck Jersey
STANFORD JERSEY
stanford jerseys
tennessee jersey
Joey Aguilar Jersey
DeSean Bishop Jersey
Chris Brazzell II Jersey
Star Thomas Jersey
Peyton Manning Jersey
Braylon Staley Jersey
vols jersey
Peyton Manning Tennessee Jersey
vols jerseys
Eric Berry Jersey
Peyton Manning Jersey
aggies jerseys
Johnny Manziel Jersey
Marcel Reed Jersey
Mike Evans Jersey
aggies jersey
Johnny Manziel Jersey
longhorns pro shop
Parker Livingstone Jersey
Michael Taaffe Jersey
Quintrevion Wisner Jersey
Matthew Caldwell Jersey
Ryan Wingo Jersey
DeAndre Moore Jr. Jersey
longhorns pro store
Arch Manning Jersey
Michael Taaffe Jersey
Quintrevion Wisner Jersey
Ryan Wingo Jersey
ucf knights jerseys
ucf jersey
usc pro store
Reggie Bush Jersey
O.J. Simpson Jersey
Troy Polamalu Jersey
west virginia jersey
Tavon Austin WVU Jersey
Geno Smith WVU Jersey
Pat McAfee WVU Jersey
wisconsin jerseys
J. J. Watt Jersey
wisconsin jersey
alabama crimson tide jersey
mamba jerseys
shop oklahoma sooners
bama shop now
Derrick Henry Jersey
DeVonta Smith Jersey
Ha Ha Clinton-Dix Jersey
Jalen Hurts Jersey
Mark Ingram Jersey
Nick Saban Jersey
Tua Tagovailoa Jersey
gators jersey
lsu tigers football jerseys
Garrett Nussmeier LSU Tigers Jersey
Caden Durham LSU Tigers Jersey
Aaron Anderson LSU Tigers Jersey
Ju’Juan Johnson LSU Tigers Jersey
Harlem Berry LSU Tigers Jersey
Barion Brown LSU Tigers Jersey
12th man pro store
Justin Evans Texas A&M Aggies Jersey
Johnny Manziel Texas A&M Aggies Jersey
oklahoma sooners shop now
John Mateer Oklahoma Sooners Jersey
Tory Blaylock Oklahoma Sooners Jersey
Isaiah Sategna III Oklahoma Sooners Jersey
Michael Hawkins Jr. Oklahoma Sooners Jersey
Jaren Kanak Oklahoma Sooners Jersey
florida football jersey
lsu football uniform
Garrett Nussmeier LSU Jersey
Caden Durham LSU Jersey
Aaron Anderson LSU Jersey
Michael Van Buren Jr. LSU Jersey
Ju’Juan Johnson LSU Jersey
Harlem Berry LSU Jersey
oklahoma jerseys shop
John Mateer Oklahoma Jersey
Deion Burks Oklahoma Jersey
Baker Mayfield Oklahoma Jersey
wvu jerseys shop
Tavon Austin WVU Jersey
Geno Smith WVU Jersey
Pat McAfee WVU Jersey
houston cougars jersey
lsu pro shop
Garrett Nussmeier Jersey
Caden Durham Jersey
Ju’Juan Johnson Jersey
Harlem Berry Jersey
Aaron Anderson Jersey
Barion Brown Jersey
ou jersey
Baker Mayfield Jersey
Adrian Peterson Jersey
west virginia jerseys
Geno Smith Jersey
Pat McAfee Jersey
Tavon Austin Jersey
duke blue devils store
Austin Rivers Jersey
Cooper Flagg Jersey
Grant Hill Jersey
Cameron Boozer Jersey
Cayden Boozer Jersey
Kyrie Irving Jersey
shop south carolina jerseys
LaNorris Sellers Jersey
Rahsul Faison Jersey
Matt Fuller Jersey
Nyck Harbor Jersey
arkansas razorbacks shop
AUBURN FOOTBALL APPAREL
Bo Jackson Jersey
Bo Nix Jersey
baylor bears pro store
tigers football jerseys
Cade Klubnik Jersey
COLORADO BUFFALOES SHOP
duke blue devils pro store
Cooper Flagg Jersey
Cameron Boozer Jersey
Cayden Boozer Jersey
florida gators pro store
college apparel fan
12th Man College Jerseys
Geno Smith College Jerseys
Joe Montana College Jerseys
college pro store
Andrew Luck – Stanford Cardinal
Arch Manning – Texas Longhorns
Baker Mayfield – Oklahoma Sooners
Blake Corum – Michigan Wolverines
C.J. Stroud – Ohio State Buckeyes
Geno Smith – West Virginia Mountaineers
J.J. McCarthy – Michigan Wolverines
Jeremiah Smith – Ohio State Buckeyes
Johnny Manziel – Texas A&M Aggies
Ryan Williams – Alabama Crimson Tide
view college teams
clemson pro shop
Cade Klubnik Jersey
Adam Randall Jersey
Bryant Wesco Jr. Jersey
Keith Adams Jr. Jersey
T.J. Moore Jersey
clemson pro store
Cade Klubnik Clemson Tigers Jersey
Adam Randall Clemson Tigers Jersey
georgia bulldogs pro shop
Gunner Stockton Georgia Bulldogs Jersey
Chauncey Bowens Georgia Bulldogs Jersey
Nate Frazier Georgia Bulldogs Jersey
Nick Chubb Georgia Bulldogs Jersey
Zachariah Branch Georgia Bulldogs Jersey
michigan wolverines pro shop
Bryce Underwood Michigan Wolverines Jersey
Blake Corum Michigan Wolverines Jersey
Charles Woodson Michigan Wolverines Jersey
Justice Haynes Michigan Wolverines Jersey
Donaven McCulley Michigan Wolverines Jersey
youth alabama jersey
Derrick Henry College Jersey
DeVonta Smith College Jersey
Jalen Hurts College Jersey
clemson college jerseys
Adam Randall College Jersey
Cade Klubnik College Jersey
Deshaun Watson College Jersey
uga pro shop
Brock Bowers College Jersey
Colbie Young College Jersey
D’Andre Swift College Jersey
Gunner Stockton College Jersey
Lawson Luckie College Jersey
Mykel Williams College Jersey
Nate Frazier College Jersey
michigan gear shop
Bryce Underwood College Jersey
osu pro shop
Julian Sayin College Jersey
Bo Jackson College Jersey
Jeremiah Smith College Jersey
CJ Donaldson College Jersey
James Peoples College Jersey
Carnell Tate College Jersey
Max Klare College Jersey
oregon pro shop
Marcus Mariota College Jersey
ut jersey
Joey Aguilar College Jersey
DeSean Bishop College Jersey
Peyton Manning College Jersey
Braylon Staley College Jersey
texas college jersey
Arch Manning College Jersey
Bijan Robinson College Jersey
Brock Cunningham College Jersey
Colin Simmons College Jersey
Colt McCoy College Jersey
Elijah Barnes College Jersey
Isaiah Bond College Jersey
usc pro shop
Reggie Bush College Jersey
college limited jerseys
fsu pro store
wvu pro store
alabama pro store
Derrick Henry Alabama Crimson Tide Jersey
DeVonta Smith Alabama Crimson Tide Jersey
Donnie Lee Jr. Alabama Crimson Tide Jersey
Jalen Hurts Alabama Crimson Tide Jersey
florida state seminoles shop
Tommy Castellanos Jersey
Jordan Travis Jersey
Gavin Sawchuk Jersey
Duce Robinson Jersey
illinois fighting illini shop
iowa hawkeyes pro store
kansas jayhawks pro shop
kentuc kywildcats pro store
lsu tigers pro store
Garrett Nussmeier Jersey
Ja’Marr Chase Jersey
Jayden Daniels Jersey
Joe Burrow Jersey
MICHIGAN WOLVERINES PRO STORE
Blake Corum Jersey
Charles Woodson Jersey
Donovan Edwards Jersey
J.J. McCarthy Jersey
Jabrill Peppers Jersey
Jim Harbaugh Jersey
notre dame fighting pro shop
Jeremiyah Love Jersey
ole miss rebels pro shop
Jaxson Dart Jersey
USC TROJANS PRO SHOP
Caleb Williams Jersey
O.J. Simpson Jersey
Reggie Bush Jersey
WEST VIRGINIA MOUNTAINEERS PRO SHOP
Geno Smith Jersey
Tavon Austin Jersey
WISCONSIN BADGERS PRO SHOP
Jonathan Taylor Jersey
J.J. Watt Jersey
Russell Wilson Jersey
Arkansas Pro Shop
CLEMSON COLLEGE SHOP
Cade Klubnik Clemson Jersey
FLORIDA GATORS FAN GEAR
Tim Tebow Florida Jersey
FLORIDA STATE SEMINOLES PRO SHOP
Jordan Travis Florida State Jersey
georgia pro store
Gunner Stockton Georgia Jersey
George Pickens Georgia Jersey
Lawson Luckie Georgia Jersey
Oscar Delp Georgia Jersey
Stetson Bennett Georgia Jersey
Zachariah Branch Georgia Jersey
iowa pro shop
LSU TIGERS APPARELS
Garrett Nussmeier LSU Jersey
Ja’Marr Chase LSU Jersey
Joe Burrow LSU Jersey
Justin Jefferson LSU Jersey
Leonard Fournette LSU Jersey
shop michigan jerseys
Aidan Hutchinson Michigan Jersey
Blake Corum Michigan Jersey
Bryce Underwood Michigan Jersey
Charles Woodson Michigan Jersey
Colston Loveland Michigan Jersey
J.J. McCarthy Michigan Jersey
NOTRE DAME FAN STORE
Joe Montana Notre Dame Jersey
oklahoma pro shop
John Mateer Oklahoma Jersey
Tory Blaylock Oklahoma Jersey
Isaiah Sategna III Oklahoma Jersey
OLE MISS PRO SHOP
Jaxson Dart Ole Miss Jersey
Tennessee Pro Store
Joey Aguilar Tennessee Jersey
DeSean Bishop Tennessee Jersey
Chris Brazzell II Tennessee Jersey
TEXAS A&M PRO SHOP
Johnny Manziel Texas A&M Jersey
texas longhorns pro shop
Arch Manning Texas Jersey
Michael Taaffe Texas Jersey
USC FAN SHOP
Reggie Bush USC Jersey
WEST VIRGINIA PRO SHOP
Tavon Austin West Virginia Jersey
WISCONSIN PRO SHOP
- Der Pali-Kanon ist die in der Sprache Pali verfasste, älteste zusammenhängend überlieferte Sammlung von Lehrreden Buddhas ↩
- Dabei habe ich die direkte, persönliche Rede der beiden teilweise beibehalten. Wer zusammenhängende Texte sucht, findet einiges auf dieser Website. Damit sind vor allem gemeint: die Seite mit Stephens Artikel: Was ist saekularer Buddhismus?, die Seite Meditation, die vor allem auf Martines Buch zu diesem Thema basiert, die Blog-Einträge über Stephens Text: Nach dem Buddhismus, sowie über Martines Talks Die Gelübde des Bodhisattvas und Die vier Phasen des Loslassens ↩
- Aṇguttara Nikāya 6.119-139 ↩