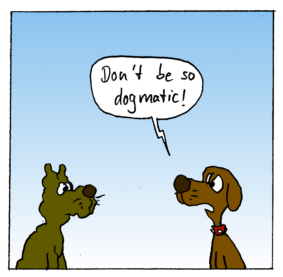Auf dieser Website haben wir schon vielfach Jason Siffs Ideen und Methoden diskutiert, mit denen wir in der Wiener Gruppe auch schon jahrelang praktizieren. Kürzlich war Jason in Österreich, um im Buddhistischen Zentrum Scheibbs ein Retreat zu leiten, und es war wieder – wie schon letztes Jahr – in vieler Hinsicht eine Inspiration. Im Gegensatz zum letzten Jahr, vielleicht auch auf Grund wiederkehrender Fragen zu der Verbindung seines Ansatzes zum Dharma (siehe auch Winton Higgins diesbezügliche Antworten in einem früheren Blog-Eintrag), hat Jason diesmal sehr viel über buddhistische Konzepte gesprochen. In guter säkular-buddhistischer Manier in seiner eigenen Interpretation. Dazu gehört auch, dass Jason bei der Übersetzung von Pali-Begriffen manchmal gerne den Weg über Nepali nimmt, das er gut versteht und das starke Einflüsse von den alten indischen Sprachen aufweist. So übersetzt er „laksana“ wie im zeitgenössischen Nepali als „Zeichen“, und nicht wie üblich als „Daseinsmerkmale“. Das mag für viele nach Haarspalterei klingen, aber diese Bedeutungsverschiebung bezüglich der klassischen drei „Zeichen“ der Existenz (dukkha, Vergänglichkeit, Nicht-Selbst) ist ein Hinweis darauf, dass es dabei nicht um abstrakte, ewige Wahrheiten geht, die uns nicht in unserer Praxis helfen, sondern um etwas, das wir konkret wahrnehmen können. Wie wir eine schwarze Wolke als Zeichen für ein Gewitter sehen können, sind die existentiellen Zeichen, wenn wir sie denn erkennen, vielleicht ein Indiz dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Auch für das erste Zeichen, dukkha, wählt Jason die konkreteste Übersetzung: Schmerz. Nicht die Geschichte, die wir uns rund um den Schmerz zusammenreimen, und auch nicht die grundsätzliche Unfähigkeit des Lebens, uns dauernde Befriedigung zu verschaffen, meint er mit dukkha, sondern einfach nur Schmerz. Allerdings, auch hier verschiebt er die Betonung wieder ein bisschen, geht es ihm doch um einen anderen Umgang mit Schmerz: Nicht (nur) wie wir darauf reagieren, sondern wie wir den Schmerz anders, genauer, kennenlernen können. Also keine schnelle, automatische Schubladisierung in der Art „Ah ja, das kenn ich schon, das ist X.“, sondern eine genauere Betrachtung, was da genau passiert, und was da vielleicht sonst noch mitschwingt, das nicht nur Schmerz ist, wie Freundlichkeit vielleicht. Vergänglichkeit, das zweite Zeichen, ist für Jason ebenfalls mehr als eine (ziemlich offensichtliche) ontologische Aussage über das Wesen der Welt, sondern auch unsere Erfahrung mit der durch sie verursachten Unsicherheit. Wie reagieren wir, wenn die Welt nicht so will, wie wir wollen? Das üblicherweise mit Vergänglichkeit übersetzte, entsprechende Pali-Wort anicca interpretiert Jason auch vielmehr als nicht nach Ritualen, Regeln und Routinen zu handeln. Es geht also um ein genaueres Kennenlernen unserer Unsicherheit und um einen nicht-rituellen, nicht-automatisierten Umgang mit ihr. Nicht anders verhält es sich mit Jasons Interpretation von anatta, normalerweise mit Nicht-Selbst übersetzt. Anstatt anatta als zu erkennende absolute Wahrheit zu sehen, oder sie vielleicht sogar noch als Grund allen Seins hochzustilisieren, geht es Jason nur um die konkrete Erfahrung. Können wir sehen, wie wir zu einer Meinung, einer Emotion, einer Ansicht werden? Wie läuft das ab mit der Identifikation? Und können wir sehen, dass Selbst nicht als eigenständige Entität existiert, sondern auf Grund von Bedingungen entsteht? Und dass gleichermaßen Nicht-Selbst nicht als eigenständige Entität existiert, sondern auf Grund von Bedingungen entsteht? Das wahrscheinlich auffälligste Merkmal von Jasons Retreats ist seine betont entspannte Herangehensweise, bei der er sogar Gute-Nacht-Geschichten vorliest. Das hängt wohl mit seiner Auffassung von „rechter Anstrengung“ zusammen, ein Thema, das wir sowohl hier wie auch in unserer Wiener Gruppe schon häufig diskutiert haben. Wie kann das Laufenlassen von Gedanken und Gefühlen etwas bewirken? Müssen wir uns nicht anstrengen, und auf etwas konzentrieren? Jasons Interpretation von „rechter Anstrengung“ weicht wiederum vom buddhistischen Mainstream ab, er wählt lieber eine unübliche Übersetzung von sammā vāyāma: Mut. Mut, unserer Erfahrung ins Auge zu schauen, Mut, zu uns selbst ehrlich zu sein. Das genauere Kennenlernen bewirkt die Veränderung. Auch das genauere Kennenlernen der Anstrengung: Schwingt hier Rigidität mit, oder Wettbewerbsgeist, oder Interesse? Für den Alltag der Praxis empfiehlt Jason mehr Gelassenheit. Er hält es für geradezu kontraproduktiv, täglich stur so und so lange zu sitzen. Seiner Ansicht nach sollte Interesse der treibende Faktor sein, nicht Disziplin. Wenn Interesse am genaueren Kennenlernen unserer Erfahrung da ist, setzen wir uns hin. Wenn nicht, dann halt nicht. Kein Grund, uns deswegen fertig zu machen. In diesem Sinne: entspanntes Sitzen!
Auf dieser Website haben wir schon vielfach Jason Siffs Ideen und Methoden diskutiert, mit denen wir in der Wiener Gruppe auch schon jahrelang praktizieren. Kürzlich war Jason in Österreich, um im Buddhistischen Zentrum Scheibbs ein Retreat zu leiten, und es war wieder – wie schon letztes Jahr – in vieler Hinsicht eine Inspiration. Im Gegensatz zum letzten Jahr, vielleicht auch auf Grund wiederkehrender Fragen zu der Verbindung seines Ansatzes zum Dharma (siehe auch Winton Higgins diesbezügliche Antworten in einem früheren Blog-Eintrag), hat Jason diesmal sehr viel über buddhistische Konzepte gesprochen. In guter säkular-buddhistischer Manier in seiner eigenen Interpretation. Dazu gehört auch, dass Jason bei der Übersetzung von Pali-Begriffen manchmal gerne den Weg über Nepali nimmt, das er gut versteht und das starke Einflüsse von den alten indischen Sprachen aufweist. So übersetzt er „laksana“ wie im zeitgenössischen Nepali als „Zeichen“, und nicht wie üblich als „Daseinsmerkmale“. Das mag für viele nach Haarspalterei klingen, aber diese Bedeutungsverschiebung bezüglich der klassischen drei „Zeichen“ der Existenz (dukkha, Vergänglichkeit, Nicht-Selbst) ist ein Hinweis darauf, dass es dabei nicht um abstrakte, ewige Wahrheiten geht, die uns nicht in unserer Praxis helfen, sondern um etwas, das wir konkret wahrnehmen können. Wie wir eine schwarze Wolke als Zeichen für ein Gewitter sehen können, sind die existentiellen Zeichen, wenn wir sie denn erkennen, vielleicht ein Indiz dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Auch für das erste Zeichen, dukkha, wählt Jason die konkreteste Übersetzung: Schmerz. Nicht die Geschichte, die wir uns rund um den Schmerz zusammenreimen, und auch nicht die grundsätzliche Unfähigkeit des Lebens, uns dauernde Befriedigung zu verschaffen, meint er mit dukkha, sondern einfach nur Schmerz. Allerdings, auch hier verschiebt er die Betonung wieder ein bisschen, geht es ihm doch um einen anderen Umgang mit Schmerz: Nicht (nur) wie wir darauf reagieren, sondern wie wir den Schmerz anders, genauer, kennenlernen können. Also keine schnelle, automatische Schubladisierung in der Art „Ah ja, das kenn ich schon, das ist X.“, sondern eine genauere Betrachtung, was da genau passiert, und was da vielleicht sonst noch mitschwingt, das nicht nur Schmerz ist, wie Freundlichkeit vielleicht. Vergänglichkeit, das zweite Zeichen, ist für Jason ebenfalls mehr als eine (ziemlich offensichtliche) ontologische Aussage über das Wesen der Welt, sondern auch unsere Erfahrung mit der durch sie verursachten Unsicherheit. Wie reagieren wir, wenn die Welt nicht so will, wie wir wollen? Das üblicherweise mit Vergänglichkeit übersetzte, entsprechende Pali-Wort anicca interpretiert Jason auch vielmehr als nicht nach Ritualen, Regeln und Routinen zu handeln. Es geht also um ein genaueres Kennenlernen unserer Unsicherheit und um einen nicht-rituellen, nicht-automatisierten Umgang mit ihr. Nicht anders verhält es sich mit Jasons Interpretation von anatta, normalerweise mit Nicht-Selbst übersetzt. Anstatt anatta als zu erkennende absolute Wahrheit zu sehen, oder sie vielleicht sogar noch als Grund allen Seins hochzustilisieren, geht es Jason nur um die konkrete Erfahrung. Können wir sehen, wie wir zu einer Meinung, einer Emotion, einer Ansicht werden? Wie läuft das ab mit der Identifikation? Und können wir sehen, dass Selbst nicht als eigenständige Entität existiert, sondern auf Grund von Bedingungen entsteht? Und dass gleichermaßen Nicht-Selbst nicht als eigenständige Entität existiert, sondern auf Grund von Bedingungen entsteht? Das wahrscheinlich auffälligste Merkmal von Jasons Retreats ist seine betont entspannte Herangehensweise, bei der er sogar Gute-Nacht-Geschichten vorliest. Das hängt wohl mit seiner Auffassung von „rechter Anstrengung“ zusammen, ein Thema, das wir sowohl hier wie auch in unserer Wiener Gruppe schon häufig diskutiert haben. Wie kann das Laufenlassen von Gedanken und Gefühlen etwas bewirken? Müssen wir uns nicht anstrengen, und auf etwas konzentrieren? Jasons Interpretation von „rechter Anstrengung“ weicht wiederum vom buddhistischen Mainstream ab, er wählt lieber eine unübliche Übersetzung von sammā vāyāma: Mut. Mut, unserer Erfahrung ins Auge zu schauen, Mut, zu uns selbst ehrlich zu sein. Das genauere Kennenlernen bewirkt die Veränderung. Auch das genauere Kennenlernen der Anstrengung: Schwingt hier Rigidität mit, oder Wettbewerbsgeist, oder Interesse? Für den Alltag der Praxis empfiehlt Jason mehr Gelassenheit. Er hält es für geradezu kontraproduktiv, täglich stur so und so lange zu sitzen. Seiner Ansicht nach sollte Interesse der treibende Faktor sein, nicht Disziplin. Wenn Interesse am genaueren Kennenlernen unserer Erfahrung da ist, setzen wir uns hin. Wenn nicht, dann halt nicht. Kein Grund, uns deswegen fertig zu machen. In diesem Sinne: entspanntes Sitzen!
Bernd
P.S.