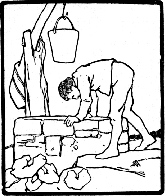Wir essen mehrmals täglich. Das eine Mal spüren und genießen wir jeden Bissen langsam und bewusst, ein anderes Mal schlingen wir hastig und unaufmerksam. Wir essen Äpfel und Müsli, Popcorn oder Broccoli, Pasta, Spinat oder Schokoriegel, Würstel, Reis, Bananen und Walnüsse. Wir essen an schön gedeckten Tischen mit unseren Freundinnen und Freunden oder im Stehen an einem Imbissstand. Manchmal essen wir zu wenig und öfter zu viel. Nachher fühlen wir uns vielleicht wohl und rundum satt, gelegentlich aber überfüllt und von Blähungen geplagt. Einmal wählen wir das Essen so, dass es im Einklang mit dem steht, was uns wichtig ist, ein anderes Mal denken wir gar nicht daran, und manchmal müssen wir uns im Nachhinein sagen: das hätte ich besser stehen lassen.
Essen ist eine schwierige Sache. Vor jeder Mahlzeit – auch wenn sie fertig vor uns hingestellt wird – sind Entscheidungen zu treffen: Wie viel esse ich? Wie schnell? Esse ich das überhaupt, oder nur Teile davon? Und es gibt kaum einen Bereich im Alltagsleben, wo man bei sich selbst und seinen Mitmenschen auf so viele Überzeugungen und unverrückbare Standpunkte stoßen kann wie hier. Lacto-, Ovo- und sonstige Vegetarier, Veganer, Frutarier, Karnivoren, Pescetarier, Flexetarier – all diese Ausdrücke stehen bei manchen Menschen für nicht mehr und nicht weniger als für ihre Weltanschauung, und die Aussagen ihrer Anhänger für Glaubenssätze. Mit der Lebensform von Buddhistinnen und Buddhisten wird meist assoziiert, sie ernährten sich vegetarisch oder sollten das zumindest tun. Als säkulare Buddhistin, Glaubenssätzen gegenüber kritisch distanziert, möchte ich über diese Frage nachdenken.
Siddharta Gotama ernährte sich von pflanzlicher Nahrung und empfahl seinen Anhängern, Mönchen wie Laien, dasselbe. Er sprach von einer Ausnahme: wenn Mönchen Fleisch angeboten würde, sollten sie es unter der Bedingung annehmen und essen, dass das Tier nicht eigens für sie getötet worden sei. Diese Einschränkung zeigt, wie Buddha in seinem Denken von konkreten Lebenssituationen ausging und abhängig von deren Bedingungen angemessene Reaktionen empfahl. In der Metta-Sutta sagt er1:
Was es auch an lebenden Wesen gibt: Ob stark oder schwach, ob groß oder klein, ob sichtbar oder unsichtbar, fern oder nah, geworden oder werdend – mögen sie alle glücklich sein… Wie eine Mutter mit ihrem Leben ihr einzig Kind beschützt und behütet, so möge man für alle Wesen und die ganze Welt ein unbegrenzt gütiges Gemüt erwecken: ohne Hass, ohne Feindschaft, ohne Beschränkung, nach oben, nach unten, nach allen Seiten.
Und die erste der 5 Silas, der später entstandenen buddhistischen Lebensregeln, lautet:
Ich gelobe, mich darin zu üben, kein Lebewesen zu töten oder zu verletzen.
Was kann das für unsere Gegenwart bedeuten? Es gibt ein schönes Interview mit Gerhard Weisgrab, dem Präsidenten der Österreichischen Buddhistischen Gesellschaft, mit dem Titel: Darum sind nicht alle Buddhisten Vegetarier 2. Weisgrab weist darauf hin, dass im Buddhismus der Unterschied zwischen Tier und Mensch im Vergleich mit anderen Religionen für geringer gehalten werde: der Mensch werde nicht als die Krone der Schöpfung gesehen mit dem Auftrag, sich die Erde untertan zu machen 3. Mensch und Tier seien sich auch deshalb näher als in anderen Religionen, weil keinem von beiden eine Seele, also ein unveränderlicher Wesenskern, zugesprochen werde. Mitgefühl mit allen fühlenden Wesen sei von zentraler Bedeutung für Buddhistinnen und Buddhisten, es solle unser Handeln in allen Bereichen – also auch in unserem Essverhalten – durchdringen und bestimmen. Da Buddhismus aber auf Eigenverantwortung beruhe und keine Dogmen kenne, existierten auch keine allgemein verbindlichen Speiseregeln. So ist also jede einzelne von uns aufgerufen, selber darüber zu entscheiden, was sie essen will, und das – zumindest für sich selber – zu begründen. Das will ich versuchen. …für alle Wesen und die ganze Welt ein unbegrenzt gütiges Gemüt zu erwecken… lautet unser Auftrag. Für alle Wesen: also außer für uns Menschen für alle Tiere und Pflanzen. Dokus von Hühnern in Mastkäfigen, von Gänsen, die gestopft werden und von Schweinen, die sich aus Raumnot gegenseitig anfressen, erschüttern. Das Fleisch von Tieren, die solches durchgemacht haben, ist wahrlich ungenießbar. Unser Mitgefühl soll auch den Pflanzen gelten. Sie haben Stoffwechsel, bewegen sich, vermehren sich und reagieren in vielfältiger Form auf Reize. Ein Sonnenblumenfeld im Sommer, wo die Blüten sich mit dem Stand der Sonne drehen, ist ein schönes Beispiel dafür 4.
Von dem Satz ausgehend, dass der Mensch nicht die Krone der Schöpfung sei, kann ich nicht sehen, warum mir Tiere näher stehen sollten als Pflanzen. (Sie tuns auch nicht. Der Anblick eines stattlichen Baumes geht mir persönlich eher nahe als der eines hübschen Kätzchens.) Jedenfalls: Hierarchisierung von MItgefühl verschiedenen Lebewesen gegenüber – das stimmt für mich nicht. Ein großer Teil der Lebensmittel, die uns heute – typischerweise im Supermarkt – angeboten werden, stammt nicht aus artgerechter Haltung, und zwar unabhängig davon, ob es sich um pflanzliche oder tierische Nahrung handelt. Das Prinzip industrieller Produktion ist in Legebatterien oder Schweinemastbetrieben dasselbe wie in riesigen Monokulturen von Mais oder Getreide mit all ihren negativen Folgen für Resistenz und Krankheits- bzw. Schädlingsanfälligkeit. Die systematische Gabe von Antibiotika in der Tierzucht entspricht dem exzessiven Einsatz von Dünge- und Schädlingsbekämpfungsmitteln im Ackerbau. Für mich verläuft bei diesen Fragen die Haupt-Bruchlinie, wenn ich mich täglich entscheiden muss, was ich einkaufe 5. Unsere Aufgabe als Menschen ist es, auf die Wesen, die auf der Welt leben, acht zu geben, auf Pflanzen wie Tiere gleichermaßen, und auf die Ressourcen, die wir verbrauchen. Davon ausgehend ist für mich das starke Argument gegen Fleischverzehr nicht selektive Tierliebe sondern die Tatsache, dass für die Erzeugung tierischer Nahrungsmittel ein Vielfaches an Boden, Wasser und Energie draufgeht wie für pflanzliches Essen, Analoges gilt für die Emissionen von Treibhausgasen als Hauptverursacher des Klimawandels 6. Eins sollte uns jedenfalls klar sein: Fast durch alles, was wir Menschen tun, um Nahrung zu erwerben oder zuzubereiten – abgesehen nur vom Sammeln abgefallener Früchte oder Nüsse – werden andere Lebewesen getötet oder geschädigt. An dieser Tatsache – aus der hier bestimmt kein Glaubenssatz gemacht werden soll – können wir nichts ändern. Sie kann uns nur die große Verantwortung deutlich machen, die wir in unserem Essverhalten tragen – ob wir das sehen wollen oder nicht.
Also: ohne Kompromisse wird es nicht gehen. An schrankenlosem Mitgefühl mit allen Lebewesen würden wir verhungern.
Ich versuche, es als eine Art Richtschnur zu nehmen, und außerdem meinen Menschenverstand zu gebrauchen. Ich gehe lieber auf Märkte als in den Supermarkt. Ich möchte Dinge kaufen und essen, die aus biologischem Anbau stammen oder sonst möglichst naturnah gezogen wurden. Besonders wichtig sind mir kurze Transportwege, daher kaufe ich fast nur heimische Ware. Ich greife so selten wie möglich zu fertig Verpacktem. An Obst und Gemüse gibt es bei mir nur das, was hierzulande gerade reif ist. Gern greife ich zu „unspektakulären“ Sorten wie Sellerie, Karotten, Kohlrüben und Äpfeln. Ich gebe mehr auf den Geschmack als auf das Aussehen. Exotisches lasse ich weg. Sehr selten esse ich Fleisch, und wenn ich es tue, achte ich auf artgerechte Haltung der Tiere.
- eine schöne deutsche Übersetzung dieser „Lehrrede von der Liebenden Güte“, eines zentralen Texts aus dem Pali-Kanon, findet sich unter: http://www.buddhachannel.tv/portail/spip.php?article11143 ↩
- http://derstandard.at/1361240395145/Religion-und-Tiere-Warum-nicht-alle-Buddhisten-Vegetarier-sind ↩
- s. Altes Testament, Gen. I, 28 ↩
- Zu diesem Thema ist im Jahr 2012 das sehr interessante Buch: What a Plant knows von Daniel Chamovitz, dt.: Was Pflanzen wissen, erschienen. Der Autor, Professor für Pflanzenbiologie, geht darin auf jeden einzelnen Sinn von Pflanzen ein: Sie sehen, riechen, fühlen, hören, „wissen“ etwas über sich selbst und erinnern sich. Dabei wird klargestellt, dass Pflanzen nichts im menschlichen Sinn wissen können, da ihnen das Gehirn fehlt, um Sinneseindrücke zu verarbeiten. Trotzdem – so der Biologe – gelingt es ihnen, ihre Umwelt wahrzunehmen und darauf zu reagieren ↩
- Das Argument, dass wegen der wachsenden Weltbevölkerung industrielle Lebensmittelproduktion in großem Stil unverzichtbar sei, ist für mich angesichts der Tatsache, dass weltweit ein Drittel der erzeugten Nahrungsmittel weggeworfen wird, höchst fragwürdig. Daher habe ich große Sympathien für Freeganer – das sind die Leute, die ihre Lebensmittel ganz oder teilweise aus den Abfalltonnen von Supermärkten beziehen ↩
- s. z.B. http://www.peta.de/umwelt ↩





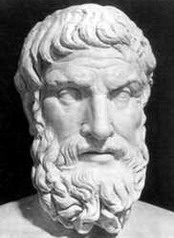

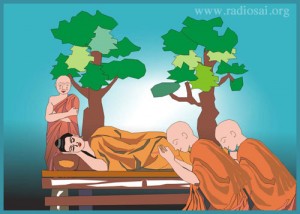

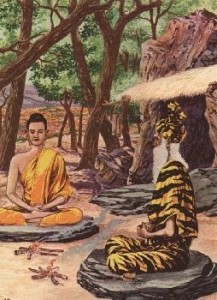 König Bimbisara und Siddharta Gotama
König Bimbisara und Siddharta Gotama